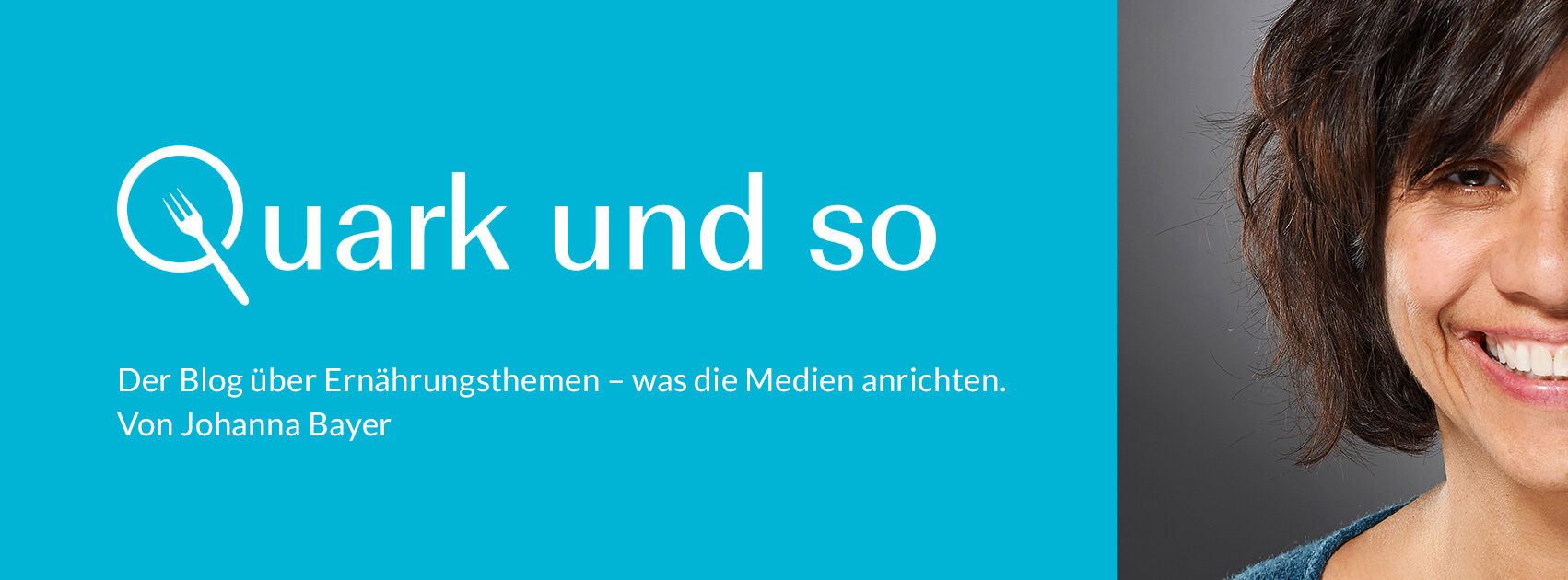In der ZEIT haben zwei Journalisten mit zwei Forschern über Essen gesprochen. Einer ist der Food-Ethnologe Marin Trenk, der sich ganz ausgezeichnet mit fremden Kulturen und exotischen Gerichten auskennt. Die andere ist Christine Ott, eine Romanistin und Literaturwissenschaftlerin. Sie tritt als Expertin für alles auf, von frühkindlichen Prägungen bis zu politischer Soziologie. Und unvermittelt stehen wir im Gruselkabinett der Laberfächer.
Zwei Reporter und zwei Forscher auf lustiger Food-Safari, das klingt eigentlich nach leichter Kost. Zumal das interview in ZEIT-Campus erschien, dem Uni-Ableger der ZEIT.
Daher sollte es wohl etwas für Studenten und leicht verdaulich sein.
Das Ergebnis ist aber in Teilen so falsch und irritierend, dass die Sache auf Quarkundso.de gründlich behandelt werden muss.
Dabei war alles so nett und lustig aufgezogen – eine kurzweilige „Food-Safari“ durch die Frankfurter Kleinmarkthalle sollte es sein, ein „Menü in vier Gängen“.
Die Fragen waren auch nett und harmlos, sie galten den Lieblingstrends der jungen Generation, Pizza, Döner, Instagram und so. Einer der beiden Wissenschaftler, die antworten sollten, war Marin Trenk. Er ist Spezialist für Kulinarische Ethnologie und kennt sich ganz ausgezeichnet mit Essen, fremden Esskulturen und globalen Trends aus.
Die andere war die Literaturwissenschaftlerin Christine Ott, Professorin für italienische und französische Literaturwissenschaft. Von der ZEIT wird sie beschrieben als eine Forscherin, die untersucht, wie „Kultur, Nation und Ernährung zusammenhängen“.
Aha? Das ist die Aufgabe einer Romanistin? Klingt eher nach einem großen internationalen Sonderforschungsbereich zur Soziologie der Agrarwirtschaft.
Wie sich noch herausstellen wird, ist diese Profilbeschreibung alles andere als zufällig.
Nur nach Bauchgefühl
Jedenfalls hat Christine Ott im Frühjahr 2017 ein Buch bei S. Fischer veröffentlicht, Titel: „Identität geht durch den Magen. Mythen der Esskultur“.
Den dicken Schinken, ein 500-Seiten-Opus, haben wir übrigens nicht gelesen, anders als das faszinierende Buch von Marin Trenk über globalisiertes Essen.
Was die Romanistin angeht, begnügt sich Quarkundso.de also mit dem ZEIT-Interview. Wir gehen dabei nur nach dem unmittelbaren Augenschein vor – und natürlich nach Bauchgefühl, bei Quarkundso.de das Maß aller Dinge.
Die Fragen der Journalisten waren naheliegend: Warum fotografieren Menschen ihr Essen, warum ist die Avocado hip, warum gilt die Pizza als italienisches Nationalgericht, woher kommt der Döner – was Studenten halt so wissen wollen.
Trenk antwortet präzise und aufschlussreich, er ist weitgereister Ethnologe und weiß, woher das Essen kommt.
Ott antwortet auch. Aber keineswegs als Literaturwissenschaftlerin. Nur ein einziges Mal nimmt sie Bezug auf einen Roman.
Delikatessen essen als „Inszenierung“
Stattdessen spricht sie über Essen ganz allgemein, genauer gesagt deutet oder interpretiert sie alles rund ums Essen.
Und erklärt dabei schlechterdings die Welt: frühkindliche Prägungen, die Entwicklung von Ich und Identität, Distinktion und Abgrenzung zwischen Menschen, Schichten und Nationen, religiöse Tabus, die sexuelle Befreiung, Transkulturalität, Europaskepsis, Nationalchauvinismus, das Wesen der Küchen Italiens, Japans und Frankreichs sowie Geschichte und Charakteristik einzelner Gerichte.
Das ist schon erstaunlich dafür, dass ihr Spezialgebiet eigentlich die Literatur ist. Dabei kommt man bei ihren Auslegungen ins Grübeln, zum Beispiel, als es um Austern geht.
ZEIT Campus: In der Austernbar hier in der Markthalle bezahlt man für vier Austern mit Champagner 24 Euro. Ziemlich teuer!
Ott: Austern zu essen ist ein Zeichen von Distinktion. Allein die Inszenierung mit dem feinen Besteck, mit Porzellangeschirr und Schampus. Beim Schlürfen der Auster muss man gewisse Hemmungen überwinden, weil sie so glitschig ist und wie ein Glas Meerwasser schmeckt. Austern zu mögen muss man erst lernen. Der Soziologe Pierre Bourdieu hat die These aufgestellt, dass Menschen höherer Klassen Nahrungsmittel bevorzugen, die zum Beispiel bitter sind oder, wie die Austern, eine rohe Meeresfrucht. So hebt man sich vom Geschmack der Masse ab.
Die Sache mit der angeblichen Distinktion ist so gestrig, wir hatten das ja schon im Fall einer Soziologin am Wickel. Dass Menschen, die mehr Geld haben, sich öfter teure Sachen leisten können, ist nur ein oberflächlicher Befund, er reicht bei kulinarischen Phänomenen nicht weit.
Denn richtig hingesehen hat Ott nicht – von einer Inszenierung mit feinem Besteck kann man bei rohen Austern nicht sprechen: Sie werden in die Hand genommen und lautstark aus der Schale geschlürft.
Otts Kritik an eingebildeten Schnöseln, die zwecks Abgrenzung vom Pöbel ihren Ekel unterdrücken und glitschige Meerestiere lutschen, ist viel eher eine angelesene Schablone als eine treffende Analyse oder auch nur Beobachtung.
Überhaupt – vielleicht war die ganze Truppe gar nicht erst am Austernstand, sondern nur an der Dönerbude. Dafür spricht einiges in diesem Interview.
Muscheln: lecker, gesund, nahrhaft und bekömmlich
Dass man das Genießen von rohen Austern angeblich erst lernen muss, ist auch nur eine klassenkämpferische Luftnummer. Schließlich müssen wir alles beim Essen mögen lernen, was anders schmeckt als Muttermilch.
Das gilt besonders für so bittere Gebräue wie Kaffee oder Bier. Die sind uns weiß Gott nicht in die Wiege gelegt, aber erfreuen sich größter Beliebtheit gerade in den proletarischen Schichten.
Im Fall von Muscheln steht außerdem fest, dass sie seit Hunderttausenden von Jahren ja, seit den Anfängen der Menschheit bevorzugt verzehrt werden. Nebenbei gesagt ist das Austernessen in Frankreich nichts Luxuriöses, ebenso wenig in Asien, wo der Großteil an Austern weltweit gezüchtet und verspeist wird.
In beiden Regionen gelten diese fetten Muscheln als höchst lecker, gesund, nahrhaft und bekömmlich. Für alle. In England und den USA waren sie bis Mitte des 19. Jahrhunderts sowieso ein Armenessen, da billig und in Massen aus dem Meer zu haben.
Innereien: eine Frage, keine Antwort
Egal, das Steckenpferd von Frau Ott ist die Abgrenzung, dazu braucht sie dringend das Austern-Klischee.
Eine andere Platte hat sie auch gar nicht drauf, das zeigt sich bei der Frage nach den Innereien.
ZEIT Campus: Austern sind schick, Innereien finden viele eklig. Wieso?
Ott: Speisetabus haben der Forschung immer schon Rätsel aufgegeben. Das fängt bereits bei den religiösen Speisegeboten und Speiseverboten an, zum Beispiel im Judentum.
(…)Es gibt die funktionalistische Theorie, die besagt, dass man ein Gesetz etabliert und es einhält, um sich von anderen Kulturen abzugrenzen. Das könnte man auch auf die jüdischen oder die muslimischen Tabus beziehen. Oder auf nicht religiös fundierte Tabus.
Hier verfehlt Ott satt das Thema. Was hat das Essen von Innereien bei uns mit religiösen Speisevorschriften von Juden oder Moslems zu tun?
Und sie verzerrt die Fakten: Innereien unterliegen in Deutschland keinem Tabu, auch gab es keines in der Vergangenheit. Sie sind heute nur aus dem Blickfeld geraten. Trotzdem essen wir sie immer noch, sogar in rauen Mengen, nämlich in der Wurst.
Denn was ist der Darm, in den die Wurst gestopft wird? Auch Anteile in Wurstbrät, von Leber-, Blut-, Zungen- und Milzwurst mal ganz zu schweigen, bestehen aus Innereien. Deutschland muss sogar jede Menge Schafs- und Schweinedärme importieren, um den Hunger auf Wurst zu stillen.
Natürlich ist das nicht das, was Frau Ott meint. Aber sie haut trotzdem daneben, wenn sie auf Knopfdruck mit unpassenden Begriffen wie „Tabu“ um sich wirft, um auf ihre fixe Idee von der Abgrenzung zu sprechen zu kommen.
Diesmal haken die Journalisten aber ausnahmsweise nach: „Was ist mit Innereien?“.
Zum Glück greift dann der Fachmann ein: Marin Trenk stellt trocken fest, dass die Ablehnung von Innereien in Deutschland ein norddeutsches Phänomen ist und dass im Süden weiterhin, wenn auch rückläufig, Leber, Lunge, Milz, Zunge oder Herz in der Pfanne landen. Und ein Tabu gab es nie.
Falscher Mythos von der Pizza
Der Experte, hätte ruhig öfter reingrätschen sollen, etwa bei der Pizza.
ZEIT Campus: Die Pizza gilt als eines der italienischen Nationalgerichte. Wie kam es dazu?
Ott: Es gibt einen Mythos der Pizza. Wir wissen nicht, ob es damals wirklich so abgelaufen ist, aber die Erzählung geht so:
Im 19. Jahrhundert kam das Königspaar der noch jungen italienischen Nation zu Besuch nach Neapel. Es ging damals darum, Nord- und Süditalien ideologisch zu einen. Also erfand ein junger Pizzabäcker eine Pizza in den italienischen Nationalfarben Grün, Weiß und Rot, mit Basilikum, Mozzarella und Tomaten. Er benannte seine Erfindung nach dem Vornamen der Königin: Margherita.
Interessanterweise ist Otts Replik wieder keine Antwort auf die Frage. Damit hat sie wohl Probleme. Stattdessen verweist sie auf eine unbestätigte Anekdote, die sie zum „Mythos“ hochstilisiert, neben der Abgrenzung ihr erklärtes Lieblingsthema.
Aber sie liegt wieder daneben. Denn die Pizza gilt im Ausland nicht wegen eines cleveren Bäckers als italienisches Nationalgericht (die Legende ist von Historikern sowieso schon längst widerlegt worden, aber egal).
Auch sind die Italiener nicht begeistert davon, dass im Ausland ihre diversen ausgefeilten Hoch- und Regionalküchen mit dem Teigfladen aus Neapel gleichgesetzt werden. Zumal eine Pizza in einem regulären italienischen Mittag- oder Abendessen nichts zu suchen hat.
Wie es wirklich ist, weiß Marin Trenk, der schweigend daneben steht.
Er hat es in seinem Buch über globalisiertes Essen genau aufgeschrieben: Populär wurde die Pizza außerhalb Italiens zuerst in den USA, und zwar durch süditalienische Auswanderer vor Mitte des 20. Jahrhunderts.
In Deutschland trug die Reisewelle nach dem zweiten Weltkrieg dazu bei, dass erste Pizzerien entstanden. Sie befeuerten den Irrtum, dass die gesamte italienische Küche mit der Pizza gleichzusetzen sei.
Wie es aber im 19. Jahrhundert zur Bezeichnung der „Pizza Margherita“ (angeblich) gekommen ist, auf die Frau Ott anspielt, hat damit überhaupt nichts zu tun.
Die Hochküchen der Welt – nur Gastro-Chauvinismus?

Was Japaner können, können nur Japaner – zum Beispiel das spezielle Schneiden von Fisch. Bild: Pixabay
Es ist erstaunlich, dass der Ethnologe Trenk, ausgewiesener Kenner internationaler Esskulturen, im ZEIT-Interview die fachfremde Kollegin drauflos schwadronieren lässt.
Man kann sich gar nicht vorstellen, wie das zustande kommt: Wurde das Interview im Nachhinein zusammengekürzt, so dass falsche Aussagen entstanden?
Damit wäre Frau Ott zumindest teilweise entschuldigt. Wahrscheinlich aber ist Trenk einfach nur zu bescheiden und höflich, um ständig zu unterbrechen. Leider.
Denn die Romanistin treibt es ziemlich bunt. Die italienische Kochkunst ist für sie eine „klassische Armenküche“ – eine absichtliche Verzerrung, die historisch und kulinarisch falsch ist. Diese gezielte Umwertung wird übrigens öfter von Veganern vorgebracht, die damit ihre restriktive Ernährungsform historisch legitimieren wollen („gab es schon immer, Esskultur Italiens, eine Armenküche ohne Fleisch, deshalb so gesund!“).
Dann deutet Ott den Stolz großer Kochnationen als Hang zu gefährlichem Gedankengut:
ZEIT Campus: Welche nationalen Unterschiede gibt es heute noch beim Essen?
Trenk: In Deutschland wurde gutes Essen lange als dekadent verachtet. Stolz war man hier nur auf die Hausmannskost. Das hat sich geändert, heute essen wir mit Vorliebe global, ob Pizza, Sushi oder Thai-Curry.
Christine Ott: In Italien, Frankreich oder Japan ist das ganz anders. Nehmen wir den Gastro-Chauvinismus, der in Italien sehr ausgeprägt ist. Manche behaupten dort, nur Italiener hätten eine angeborene Kompetenz, die ideale Komposition von Nudelsorte und Soße zu bestimmen. Ich finde das bedenklich, weil das auch ein Statement gegen Transkulturalität sein kann, das sich mit Europaskepsis und nationalistischen Tendenzen verbinden lässt.
Schlimmer kann es nicht kommen.
Länder der hohen Kochkunst
Alle drei genannten Küchen gehören zu den größten der Welt. Es sind höchste Kulturleistungen, von der UNESCO als Welterbe anerkannt. Will sich Frau Ott mit der UNESCO anlegen? Bestimmt nicht. Daher wirken die politischen Bedenken der Literaturwissenschaftlerin abstrus.
Und wieder sieht die kulturelle Praxis ganz anders aus: Zu Tausenden pilgern Profis wie ambitionierte Amateure nach Frankreich, Italien und Japan, um die wahre Küche dieser Länder zu ergründen. Wenigstens ein bisschen, so gut es geht, wenn man in diese Länder nicht hineingeboren ist – jeder kennt den Unterschied zwischen von Kindheit an gelernter Kultur und angelesenem Wissen aus zweiter Hand.
Das mit der Transkulturalität wirkt auch begrifflich etwas wirr. Als ob Transkulturalität eine Art politischer oder ethischer Pflicht wäre, das ist sie natürlich nicht. Sie ist bestenfalls ein Konzept oder ein Phänomen, vielleicht aber auch nur ein Konstrukt und überhaupt umstritten.
Dabei ignoriert Ott, was in der Welt gerade vor sich geht: Überall bemühen sich Bauern, Erzeuger, Händler und Köche, vor allem aber Politiker, Gesundheitsschützer, Ämter, Vereine und NGOs darum, das traditionelle Wissen authentischer Esskulturen zu erhalten. Das ist auch die Idee des UNESCO-Weltkulturerbes. Frau Ott ist offensichtlich keine Freundin davon, bemerkenswert.
Im Gruselkabinett der Laberfächer
Jetzt stellt sich natürlich die Frage: Wie kommt die Professorin auf all das? Woher bezieht sie ihr Gedankengut und diese befremdlichen Deutungen?
Googeln hilft, und man ist nicht überrascht. Aus dem Interview in der ZEIT, aber auch anderen Interviews, Statements und Artikeln kann man Otts theoretischen Hintergrund herauslesen.
Er stammt aus dem Gruselkabinett gewisser Laberfächer: Strukturalismus und Poststrukturalismus, der Urschlamm der Psychoanalyse nach Sigmund Freud, moderne Soziologie mit der Habitus-Theorie von Pierre Bourdieu, dazu Jean Baudrillard, Roland Barthes und allerlei Postmodernes, natürlich auch Lacan und Derrida, oder, wie ein Kritiker des Schwurbels schrieb: „Lacancan und Derridada“.
Die haben schon in vielen literaturwissenschaftlichen Oberseminaren Studenten verzweifeln lassen. In anderen akademischen Disziplinen spielen sie dagegen nur selten eine Rolle, die Soziologie partiell ausgenommen. Aber die schreibt sich damit auch kein Ruhmesblatt.
Als wissenschaftlich erachtet wird der ganze Quark jedenfalls nicht. Das gilt selbst für die ehrwürdige Psychoanalyse von Sigmund Freud – den „Tiefenschwindel“ (Kritiker). Bei Freuds Person liegen die Bewertungen bis heute zwischen „Genie“ und „Scharlatan“.
So halten die Ottschen Denkstützen fast nur in literaturwissenschaftlichen Seminaren zur Analyse von Texten her, die niemand verstehen soll. Also, die Analyse. Nicht die schönen Texte. So jedenfalls formulierte es der Germanist Klaus Laermann schon 1986, als er zur Kritik des Schwurbels in seinem eigenen Fach ansetzte, übrigens in der ZEIT.
Er benannte auch das Grundübel:
„Diese Autoren „können“ grundsätzlich alles: von der Linguistik über Philosophie, Psychoanalyse, Nationalökonomie und Kunstgeschichte bis hin zur Theologie oder Judaistik.“
Auch in den Naturwissenschaften plünderten die Alleskönner munter, wie der berüchtigte Soziologe Jean Baudrillard, der sich bei Quantenphysik und Relativitätstheorie bediente.
Jetzt aber einen Schnaps
So kam es zehn Jahre nach Laermanns Kritik zu einem lustigen Skandal: Ein Physiker brachte 1996 in einer kulturwissenschaftlichen Fachzeitschrift einen Nonsens-Artikel unter, in dem er die Sprache der Schwurbler nachäffte.
Damit wollte er zeigen, dass die Zunft weder weiß, wovon sie redet noch was sie liest. Der Artikel wurde tatsächlich als Fachbeitrag veröffentlicht, nachher war der Ärger groß. Der Fall ist bekannt als Sokal-Affäre.
So viel zu dem praxisfernen Deutungswahn der Romanistin Ott und ihren verzerrten Wahrnehmungen. Es ist wohl der Pressearbeit des Verlages zu verdanken, dass sie damit seit Erscheinen ihres Buches durch die Redaktionen gereicht wird.
Zum Beispiel war sie auch bei der TAZ, wo sie offen über ihr Ziel sprach:
Mein Buch ist nicht zuletzt ein Versuch, die heute so erfolgreichen Ansätze der Ernährungswissenschaft infrage zu stellen.
Oha. Das ist sportlich.
Allerdings wurde die Grundlage ihres Zerstörungswerks, ihr dickes Buch, von wichtigen Rezensenten ziemlich zerrissen: „Eine Geschichte von fast allem“; verquaste, geschraubte Sprache, fragwürdige Deutungen, komisches Zeug, mangelnde Erfahrung und Empirie, nichts passt zusammen, „akademischer Heavy Metal, und leider ein Beispiel dafür, warum der Graben zwischen Wissenschaft und Gesellschaft tief ist“. Das warfen ihr SPIEGEL und FAZ vor.
Natürlich lassen wir uns bei Quarkundso.de nicht von böswilligen, neidischen Kritikern beeinflussen. Die schreiben über das Buch, wir dagegen haben nur ein einziges Interview kommentiert und ein bisschen gegoogelt.
Aber das reicht.
Wir schließen uns daher dem letzten Satz des FAZ-Rezensenten rückhaltlos an: „Jetzt brauchen wir einen Schnaps“.
©Johanna Bayer
Das ZEIT-Interview mit Marin Trenk und Christine Ott
Ott erklärt der TAZ, dass sie die Ernährungswissenschaften entthronen möchte
Rezension in der FAZ von Jakob Strobel y Serra
Rezension im SPIEGEL von Gastro-Autor Ullrich Fichtner