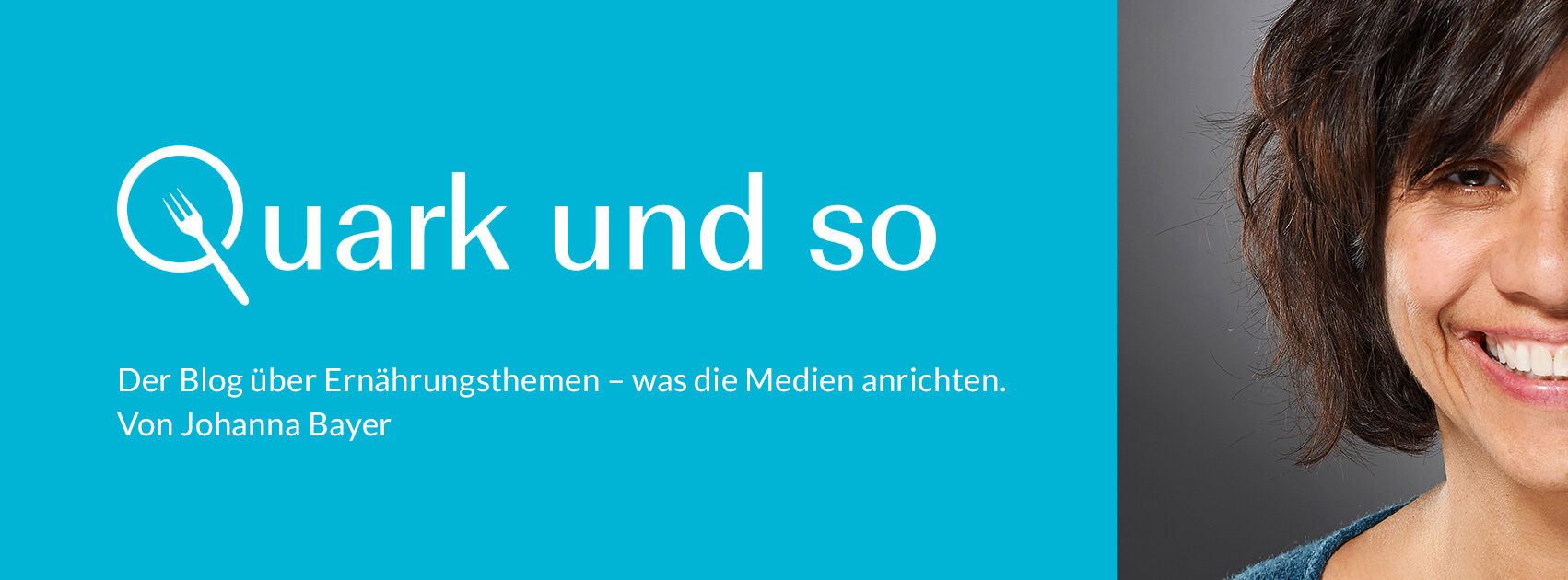Prickelnde Bläschen in Mineralwasser und Champagner sind unwiderstehlich – unser Gehirn liebt Sprudel, sagen Fachleute und Redaktionen. Ist das so? Quarkundso.de behauptet mal wieder das Gegenteil.
Rund um das Sommerloch geht nur ganz was Leichtes.
Wir beschäftigen uns daher mit Bläschen – Blubber, wie er etwa in Champagner perlt oder in Mineralwasser sprudelt. Ein wunderbares Thema, aufgebracht von Forschern am Institut Pasteur in Paris, übernommen von Redaktionen, Institutionen und Fachblättern.
Mit dabei war auch das Bundeszentrum für Ernährung in Karlsruhe, das BZfE – und der Radar von Quarkundso.de meldete das Objekt als verdächtig.
Titel des BZfE war nämlich: „Warum liebt unser Gehirn Bläschen?“, eine als Frage getarnte veritable Sachbehauptung. Demnach ist „unser“ Gehirn dafür verantwortlich, dass „wir“ alle Kohlensäure in Getränken lieben.
Neurologisch unumgänglich quasi, also bei allen Menschen gleich, womöglich evolutionär bedingt.
Unangenehm pieksender Sprudel
Aber das Mutmaßen über die Evolution und das angeblich Zwingende von Geschmackserlebnissen ist fast immer falsch.
Das zeigt sich daran, dass eben nicht alle Menschen Bläschen lieben. In der Redaktion von Quarkundso.de zum Beispiel verhält es sich völlig anders.
Nun ist das Gehirn der Chefredakteurin bekannt neurodivers, das erschwert die Lage. Fakt ist trotzdem: Die Chefin liebt den Sprudel nicht, schon gar nicht in Wasser, aber auch nicht zu penetrant in Sekt, Champagner oder Prosecco.
Schon als Kind hat sie spitze Bläschen reklamiert und einen Löffel verlangt, um die Kohlensäure aus der Limo zu rühren. Auf den Tisch in der Redaktion kommt nur stilles Wasser, übrigens nicht eiskalt aus dem Kühlschrank, sondern zimmerwarm.
Und das geht vielen Menschen so – sogar der großen Mehrheit auf der Welt.
Man muss sich dazu nur die Trinkgewohnheiten in anderen Kulturen ansehen. Auch in Blick in die Getränkekarten von Restaurants lohnt sich, in denen selbstverständlich immer auch stilles Wasser steht.
Perlage: Bitte fein und cremig
Dazu gleich mehr, jedenfalls liefern auch die Sprudelgetränke selbst keinen zwingenden Beweis für die steile These vom Gehirn.
Bei Champagner zum Beispiel führt die traditionelle Flaschengärung zu besonders feinen Bläschen – eine zarte Perlage ist dabei geradezu ein Verkaufsargument.
Weinhändler wissen, wie stark die Kohlensäure in ihren Flaschen britzelt, denn unweigerlich kommen Kunden, die eine Kreszenz mit leichter, cremiger Perlage verlangen. Grobes, dominantes Stechen auf der Zunge ist eher unerwünscht und typisch für billiges Zeug mit zugesetzter Kohlensäure, etwa Frizzante.
Deshalb werden auch viele andere Schaumweine wie Crémants und Winzersekt mit der aufwändigen Flaschengärung hergestellt, damit die Bläschen nicht zu spitz prickeln und sich am Gaumen das Champagnergefühl einstellt.
Die Behauptung, dass „unser Gehirn Bläschen liebt“, ist also einigermaßen undifferenziert. Sie stammt allerdings auch nicht vom BZfE direkt, sondern vom Institut Pasteur in Paris.
Was Kohlensäure auf der Zunge macht
Quelle der BZfE-Meldung ist nämlich ein launiges Video des Instituts, herausgebracht zu Neujahr 2025. Darin erklärt ein Hirnforscher, der sich, Achtung, auf Geschmack und Gedächtnis spezialisiert hat, wie sprudelnde Getränke den Geschmacksinn stimulieren können.
Anlass ist die Festzeit rund um das Jahresende, Weihnachten und Neujahr, zu der in vielen Familien Champagner und Sprudelndes auf den Tisch kommt.
Interessanterweise geht der Neurowissenschaftler Gabriel Lepousez vor allem auf die vertrauten Rituale ein, mit denen der Genuss von Champagner und gutem Sekt einhergeht.
Die rein naturwissenschaftliche Seite gibt er eher nebenbei wieder: Kohlensäure kann bestimmte Geschmäcker verstärken, zum Beispiel Süßes, und regt die Säure-Rezeptoren in den Geschmackspapillen an.
Am Ende nur Geschmackssache
Doch sein Fazit nimmt Bezug auf das Drumherum und Speichern dieser Erlebnisse: besondere Anlässe, festliches Essen, Familie, Freunde, die Erinnerung an schöne Momente.
So zitiert die Pressestelle des Instituts den Forscher:
“Pour Gabriel : « Derrière ces sensations uniques, il y a des émotions qui rendent ces instants encore plus mémorables. »”
"Hinter diesen einzigartigen Sinnesreizen stehen Gefühle, die solche Momente erinnerungswürdig machen"
Es sind also vor allem die positiven Gefühle und Verbindungen, die im Gehirn abgespeichert werden, so dass spritziger Champagner gleich in Festlaune bringt.
Der Blubber ist es nicht alleine und wohl auch nicht vornehmlich.
Dazu passt, dass andere Experten klar sagen: Ob Sprudel oder nicht ist reine Geschmackssache, etwa beim Wasser. Die Vorlieben – mit oder ohne – sind sehr unterschiedlich, so erklärt der Gastroenterologe Jörg Schirra von der TU München in einem Interview mit dem Bayerischen Rundfunk:
„Der Unterschied zu stillem Wasser ist die für manche Leute etwas erfrischendere Wirkung durch die Gasfreisetzung im Mund-Rachenraum. Letztlich wie der Unterschied zwischen Wein und Sekt und damit reine Geschmackssache,“ erklärt Prof. Dr. Jörg Schirra, Gastroenterologe und Oberarzt am Klinikum der Universität München
Quelle: Bayerischer Rundfunk, Beitrag vom 18.7.2024 BR-Online.de
Für manche Leute, sagt der Mediziner, und nur „etwas“ erfrischender. Wir ahnen: Auch Dr. Schirra ist, wie wir, von der Stilles-Wasser-Fraktion.
Sehr sympathisch.
Die Zahlen sprechen
Wenn aber für „unser Gehirn“ bitzelnde Getränke so reizvoll und geschmacksfördernd wären, müsste sich das in den Konsumzahlen widerspiegeln.
Die zeigen aber genau das Gegenteil: Die Deutschen trinken zum Beispiel viel mehr Wein – still – als Sekt. Der Deutsche Weinbauverband spricht von einem Marktvolumen für Stillwein von 15,9 Millionen Hektolitern, bei Schaumwein sind es nur 2,6 Millionen Hektoliter.
In Frankreich, dem größten Schaumweinmarkt der Welt, fällt immer noch doppelt so viel Stillwein wie Schaumwein an.
Mineralwasser mit Kohlensäure wiederum ist ein echt deutsches Phänomen: Die Deutschen trinken mehr Sprudel als alle anderen Völker der Erde.
Die hiesige Mineralwasserindustrie lässt folglich keine Gelegenheit vergehen, um auf die so erfrischende, prickelnde Kohlensäure hinzuweisen.
Die kann angeblich sogar „die Geschmacksknospen reinigen“. Das allerdings halten wir für ein Gerücht. Im Mund mit seinem dichten Bakterienfilz wird beim Essen und Trinken gar nichts gereinigt. Wenn, dann wird Geschmack neutralisiert, weil die Geschmacksnerven einen neutralen Reiz bekommen.
Deshalb trinken Profi-Verkoster bei Wein- oder Essensproben Wasser zwischendurch – allerdings stilles Wasser.
Nicht Sprudel, damit weder die Kohlensäure noch Salz und mineralischer Geschmack den Gaumen ablenken.
Tiere mögen keinen Sprudel
Vielleicht stammt das Gerücht auch daher, dass Sprudelwasser im deutschen Sprachraum erstmals von einem Apotheker namens Schweppes hergestellt wurde, der Ende des 18. Jahrhunderts Heilwasser mit Kohlensäure haltbar machen wollte.
Bis heute ist die konservierende Wirkung ein wichtiger Grund für Blasen in der Wasserflasche, auch daher könnte das Gerücht stammen, Kohlensäure würde die Geschmackspapillen irgendwie reinigen und desinfizieren.
Der für manche Menschen erfrischende Eindruck kommt jedenfalls vom spürbaren Britzeln, aber auch vom etwas niedrigeren pH-Wert im Sprudel: Kohlensäurehaltiges Mineralwasser hat einen Wert von 5,5 bis 6 und ist damit leicht sauer. Reines Wasser oder Leitungswasser hat einen pH-Wert von 7 bis 8,5 und ist damit neutral bis leicht alkalisch.
Sensible Schmecker nehmen die Säure und den niedrigeren pH-Wert wahr – und trinken daher vor allem zum Essen lieber stilles Wasser oder Leitungswasser.
Auch für Magenkranke, Menschen mit Sodbrennen, Blähungen oder einem Reizdarmsyndrom und Babys ist stilles Wasser eindeutig die bessere Wahl – was darauf hinweist, was die Natur für uns vorgesehen hat.
Als Tränkwasser für das liebe Vieh taugt Blubberwasser auch nicht – Tiere mögen keinen Sprudel und können davon sogar krank werden.
Forscher sind auch nur Verkäufer
Soweit also die Sachlage. Der Vollständigkeit halber verweisen wir noch auf die Masse von Beiträgen und Tipps im Netz, die auf die Vorzüge und Nachteile von Kohlensäure für Gesunde, Kranke, Alte und Kinder eingehen.
Und fragen uns gerade deshalb, warum ausgerechnet die Experten des BZfE der launigen Meldung der Pariser zum neuen Jahr nicht etwas Hintergrund hinzufügen konnte.
Es wäre uns auch egal, wenn nicht die ewige Plattitüde von „unserem Gehirn“ dabei gewesen wäre. Da schlägt der Radar von Quarkundso.de einfach an, wir können das nicht stehen lassen.
Sicher, der Pariser Forscher hat das so in den Raum gestellt, aber im Ernst – das ist nur Forschungsmarketing, um sich ins Gespräch zu bringen.
Hat geklappt. Aber gerade dem BZfE hätte klar sein müssen, dass es so platt nicht ist. Etwas Recherche hätte ergeben, was Gabriel Lepousez wirklich meint: nämlich das Abspeichern positiver Erlebnisse rund um Essen.
Und nicht davon, dass die Evolution oder die Natur uns auf Sprudelgetränke geprägt hat.
Dieses Raunen über Gehirn und Evolution ist für viele Autoren sehr verführerisch, geradezu ein Topos. Der bildet das erklärte Lieblingsdilemma, wenn es um die Lust am Essen geht, um Übergewicht, Völlerei, Naschen oder ungesunde Gewohnheiten: Wir können gar nicht anders! Unser Gehirn! Die Evolution!
Doch Geschmack und persönliche Vorlieben sind veränderbar, steuerbar, oft erlernt und immer auch kulturell bedingt. Dafür steht auch die Arbeit des renommierten Neurowissenschaftlers Gabriel Lepousez, der in Paris erforscht, wie plastisch, lernfähig und formbar unser Gehirn ist. Sogar beim Essen.
Vielleicht sollte sich ein Institut mit der Expertise, wie sie das BZfE eigentlich besitzt, an diesem platten Populismus nicht beteiligen.
@Johanna Bayer
BZfE, Meldung vom 14.5.2025: „Warum liebt unser Gehirn Bläschen?“
Prof. Dr. Jörg Schirra im Bayerischen Rundfunk über Sprudel – reine Geschmackssache
LINK zur Spende: Sie landen bei PayPal - dann geht es völlig unkompliziert, ohne eigenes PayPal-Konto.