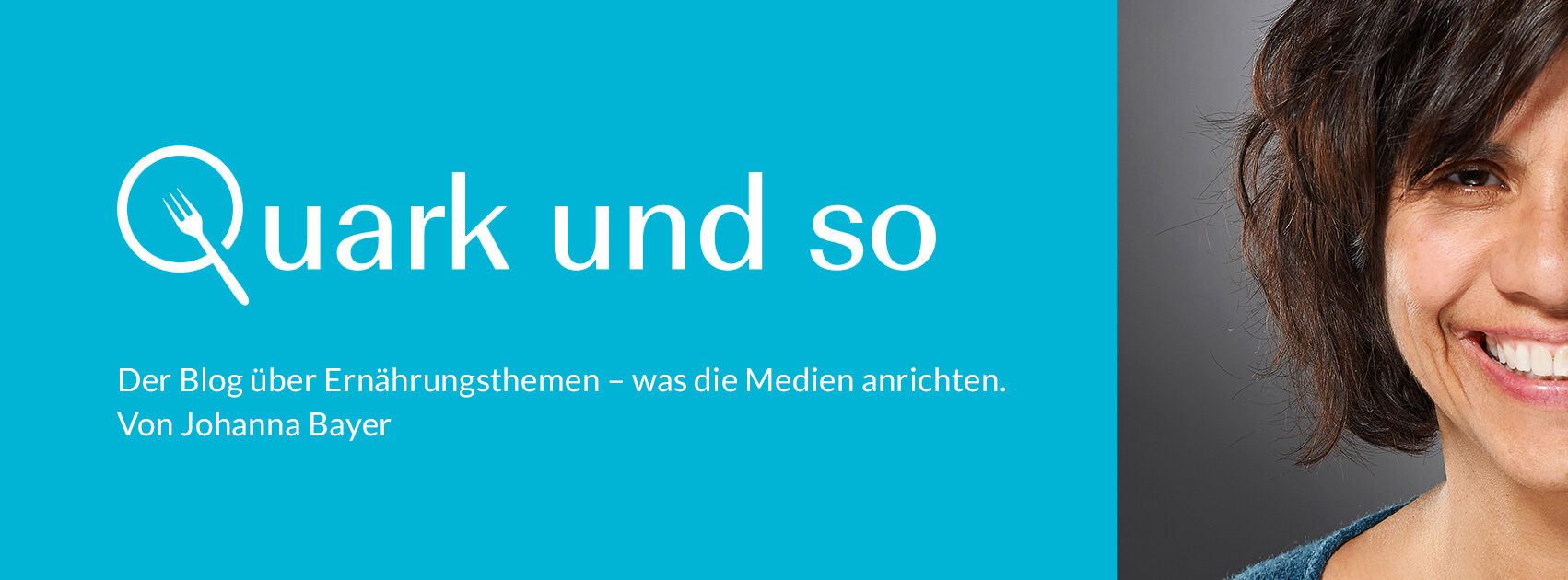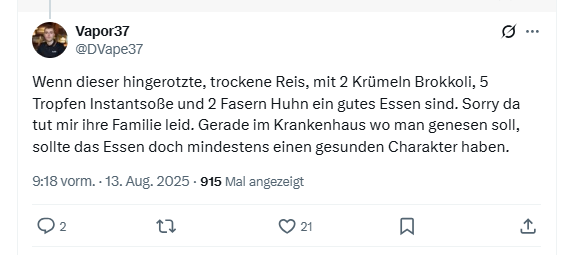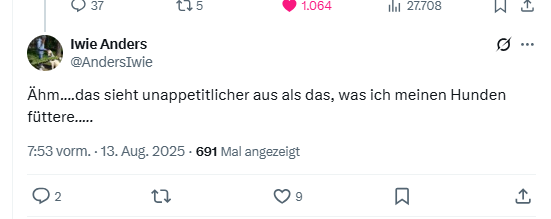Der MDR behauptet, dass Krankenhausessen ungesund ist und beruft sich auf eine Studie. Doch kann das sein? Arbeiten in Krankenhäusern nur Dilettanten und Sadisten, die Menschen noch kränker machen wollen als sie schon sind? Wir meinen: Definitiv nicht.
Der Sommer ist vorbei, Schluss mit Spaßbeiträgen wie dem zu Bläschen im Champagner. Wir wenden uns anderen Themen zu, ernsten: Es geht um Kranke.
Um Menschen, die mit schlimmen Verletzungen oder Gebrechen in Kliniken liegen. Genauer: Es geht um das, was sie essen, und damit steht es nicht gut.
Jeder weiß es: Essen im Krankenhaus ist bestenfalls öde, schlimmstenfalls ungenießbar: graue Matsche ohne Salz, ohne Gewürze, ohne Textur.
Massenweise kursieren dazu Fotos in den sozialen Netzen, auf den Tellern zu sehen sind etwa Reis (zu weiß), Hühnerfrikassee (faserig), Brokkoli (zerkocht) und weiße Tunke (ungewürzt).
Aber es kommt schlimmer: Eine Studie soll ergeben haben, dass Essen im Krankenhaus sogar ungesund ist, krank macht – noch kränker – und dazu schädlich für Klima und Umwelt.
So titelte der MDR im Juli unter der Dachzeile „Internationale Studie“:
Krankenhaus-Essen ist ungesund und umweltschädlich
Das klingt wie die Bewertung eines Wurstwagens am Bahnhofseck. Oder wie das Urteil strenger Ernährungshüter über der Deutschen liebstes Sommeressen: Steak vom Grill.
Aber nein, die Studie, auf die der MDR sich bezieht, widmete sich dem Essen in zwei deutschen Krankenhäusern sowie in drei Pflegeheimen. Nicht eben viel für so ein allgemeines Urteil. Aber von solchen Feinheiten lässt sich der ARD-Sender MDR nicht beirren und fasst die Ergebnisse so zusammen:
„Das Essen in deutschen Kliniken und Pflegeheimen ist ungesund und umweltschädlich. Laut einer neuen Studie gibt es zu wenig Gemüse, Obst und Vollkorn, dafür zu viel Weißmehlprodukte, Zucker, Salz, gesättigte Fette und rotes Fleisch. Beklagt wird eine schlechte Ernährungsqualität und ein regelrechtes Gesundheitsrisiko.“
(Quelle: MDR, 29.7.2025 Screenshot liegt vor)
Keine Recherche, nichts hinterfragt
Um welche Art von Studie sich handelt und wie die Forscherinnen zu ihren Schlüssen gekommen sind, danach sucht man beim MDR vergebens.
Unter dem Text verweist nur das Kürzel „IDW“ auf die Quelle.
Der IDW ist der Informationsdienst der Wissenschaft, ein PR-Portal für Universitäten und Forschungseinrichtungen. Grundlage ist eine Pressemeldung, die die Redaktion des MDR gekürzt und umgeschrieben hat.
Mit den Studienautorinnen gesprochen oder kritisch nachgefragt hat offensichtlich niemand.
Die Hausaufgaben muss also Quarkundso.de machen – typisch, die schmutzige Arbeit bleibt immer an uns hängen: Was ist das für eine Studie? Was genau hat sie ergeben? Was stand in der Pressemitteilung, was hat der MDR selbst geprüft oder recherchiert?
Spoiler: Selbst recherchiert hat der MDR nichts. Der Inhalt des Artikels ist identisch mit der Pressemitteilung.
Für eine so steile Aussage – Krankenhausessen ist ungesund! – einigermaßen erstaunlich.
Was für eine Studie ist das?
Die Meldung zur Studie im IDW stammt vom Potsdam Institut für Klimafolgenforschung, dessen Presseabteilung das Design der Studie wie folgt schildert:
„In der weltweit ersten umfassenden Studie, die untersucht, wie gesund und umweltfreundlich das Nahrungsangebot in Gesundheitseinrichtungen ist, hat ein internationales Forschungsteam die Speisepläne und Einkaufsdaten von zwei Krankenhäusern und drei Pflegeheimen durchschnittlicher Größe in Deutschland analysiert. Die Verpflegung in den untersuchten Einrichtungen ähnelt vermutlich dem Angebot in vielen Gesundheitseinrichtungen in westlichen Ländern.
Nochmal für alle: Untersucht wurden zwei Krankenhäuser, in Zahlen: 2, sowie drei Pflegeheime, in Zahlen: 3, demnach sollen alle weiteren Häuser in ihrer Verpflegung „vermutlich ähnlich“ sein.
Eine winzige Stichprobe also, alles andere als repräsentativ.
Trotzdem hauen die PR-Profis ganz schön auf den Putz, was die Arbeit angeht. So wurde die Studie von einem „internationalen Forschungsteam“ durchgeführt.
Doch dieses besteht aus zwei deutschen Autorinnen, die am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung arbeiten, davon sitzt eine auf einer Stiftungsprofessur an der Charité, finanziert vom Potsdam-Institut.
Die dritte, ebenfalls deutsche Autorin war früher auch am Potsdam-Institut beschäftigt, der vierte ist dort Doktorand.
Alle sind also Deutsche und kommen aus demselben Stall, was für Anlage und Ergebnisse der Studie nicht ganz unerheblich ist – wenn man böse sein wollte, könnte man das einen „inside job“ nennen.
Aber wir sind ja nicht böse, wir sagen nur, wie es ist: Differenzierte Forschungsarbeit kann man von so einem Stromlinien-Team kaum erwarten. Und richtig international ist es auch nicht.
Publiziert in der Hauspostille
Noch dazu ist die Studie im Journal „Lancet“ erschienen, das mit der EAT-Lancet-Kommission kooperiert. Das ist das Gremium, das die Planetary Health Diet (PHD) erfunden hat.
Die wiederum gilt in der Studie als Maßstab für klimafreundliche Ernährung in Krankenhäusern. An dem neuesten EAT-Lancet-Report hat das Potsdamer Institut auch noch selbst mitgewirkt – wissenschaftlich objektiv und ohne Interessen kommt uns das nicht vor.
Was an der Studie so neu und weltweit einzigartig sein soll, ist nun, dass „gesunde Ernährung“ und „Klimaschutz“ gleichzeitig untersucht werden.
Dafür ziehen die Autorinnen neben der PHD, die „gesund für den Menschen und für den Planeten“ sein soll, den sogenannten Healthy Eating Index (HEI) heran.
Das ist eine Skala, die die Empfehlungen nationaler Ernährungsgesellschaften zusammenfasst, um den konkreten Verzehr damit zu vergleichen. Je näher dieser Verzehr an den Empfehlungen liegt, festgestellt mit einem Punktescore, desto günstiger für die Gesundheit.
So zumindest die Annahme.
Kritik an der Planetary Health Diet
Dazu sollten die Empfehlungen natürlich evidenzbasiert sein, also gesicherten Erkenntnissen der Wissenschaft und Erfolgen in der Praxis entsprechen.
Das gilt alleine schon für die PHD nicht: International kritisierten Fachleute seit dem Erscheinen des Konzepts 2019, dass es für die Mengen und Nährwertproportionen, die dort als „gesund“ beworben werden, keine wissenschaftliche Evidenz gibt.
Trotzdem ist die PHD weltweit populär geworden, weil die Idee dahinter –alle Menschen ernähren und dabei die Umwelt nicht überlasten – richtig ist.
Doch mehrere Analysen der Angaben in der PHD zeigten seit 2019, dass sie selbst zu Mangelerscheinungen führen kann, weil wichtige Mineralien und Vitamine wie Kalzium, Zink, Eisen und Vitamin B12 zu kurz kommen.
Diese stecken in Eiern, Milch und Fleisch, von der PHD weitgehend als unnötig erachtet. Einige Wissenschaftler empfehlen, die Planeten-Ernährung um tierische Lebensmittel zu ergänzen, um den echten Bedarf der Menschen zu decken.
Auch die Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE) hat die Angaben in der PHD kommentiert und ergänzt.
Diese Planeten-Diät aber als Krankenkost einsetzen zu wollen, wie in der Studie gefordert, erscheint eigenartig, wenn sie doch in der Praxis gerade bei Kranken zu Nährstoffmangel führen könnte – das, was die Studienautorinnen der Klinikkost vorwerfen. Fast witzig.
Interessanterweise gibt es beim Healthy Eating Index, der als Maßstab angelegt wurde, auch so einen Stolperstein: Er beschreibt je nach Land nur dort empfohlene Mengen an Nährstoffen und Anteile an Lebensmittelgruppen, und zwar für gesunde, in der Regel erwachsene Menschen.
Nicht für Babys, Alte, Stillende und Kranke.
Was Gesunden schmeckt, ist nicht gut für Kranke
Denn diese Gruppen haben andere Bedürfnisse – gerade Kranke: Wer gebrechlich, schwer verletzt oder nach einer Operation geschwächt und ans Bett gefesselt ist, verträgt vieles nicht, verdaut schlechter, braucht mehr Kalorien und mehr Protein bei weniger Volumen.
Krankenkost muss also bekömmlich und leicht verdaulich sein – „totgekocht“ in den Augen empörter Angehöriger. Die stellen Fotos von matschigem Essen ins Netz oder klagen, dass Rohkost fehlt.
Quelle: X / Twitter https://x.com/NicolettaDorner/status/1955340270691619108
Wenn aber, wie in der Studie, gemahnt wird, es müssten mehr Gemüse, Hülsenfrüchte, Vollkorn und frisches Obst aufs Kliniktablett kommen, lachen sich Diätassistentinnen kaputt.
Bohnen, Linsen und Erbsen werden im Krankenhaus höchst selten angeboten, weil sie blähen könnten – für Gesunde kein Problem.
Aber für Kranke schon. Ähnlich verhält es sich mit Rohkost und Vollkorn: schwer verdaulich, für Menschen mit Darmproblemen wie Divertikeln oder Morbus Crohn ungünstig, geradezu verboten. Die Mehrheit der älteren Patienten hat übrigens Magen-Darm-Probleme, scharf Gebratenes oder Paniertes gehen da auch nicht.
Das weiche, labberige Weizen-Toastbrot auf dem Kliniktablett hat also seinen Sinn, auch wenn es als „ungesund“ abgestempelt wird: Es ist leicht verdaulich und liefert sowohl Energie als auch Protein, und zwar – Achtung! – pro 100 Gramm mehr als Vollkornbrot aus Roggen.
Schädlich ist es aber auf keinen Fall. Mediziner wissen das sehr genau, von alters her gilt feines Weißbrot als ausgezeichnete Krankenkost, gerne übrigens mit Butter, für Leber- und Magenkranke besonders bekömmlich.
„Könnte schaden“ – oder auch nicht
Die Studienautorinnen selbst warnen eher vorsichtig vor Klinikkost:
“Meals served in health-care institutions such as hospitals and nursing homes might compromise both short-term and long-term health of patients and residents and contribute unfavourably to the institutional environmental footprint.”
„Might compromise“: Das bedeutet, Essen im Krankenhaus könnte die Gesundheit beeinträchtigen – Konjunktiv II, irrealis.
Nur eine Möglichkeit. Dasselbe gilt für den ökologischen Fußabdruck des jeweiligen Hauses.
Klar, dieser Konjunktiv ist nur ein Ritual in wissenschaftlichen Arbeiten, eine Vorsichtsphrase, falls die nächste Autorengruppe eine bessere Studie mit anderen Ergebnissen präsentiert.
Doch man muss die Floskel trotzdem als das nehmen, was sie ist: eine Einschränkung. Es gibt keine endgültigen Ergebnisse.
Der MDR schießt daher weit über das Ziel hinaus, wenn er Krankenhausessen „ungesund und umweltschädlich“ nennt.
Titel müssen knallen – aber darf man Angst schüren?
Über reißerische Titel haben wir uns schon ausgelassen, samt Beschwerde beim Presserat über den SPIEGEL. Bitte nachlesen, wird abgefragt.
Klappern gehört eben zum Geschäft, meistens ist es auch egal, ob man ein wenig übertreibt. Außerdem kommt die Vorlage von der eifrigen Pressestelle des Potsdam-Instituts:
Ungesund und klimaschädlich: Essen in Krankenhäusern und Pflegeheimen untersucht
Corinna Bertz Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung
Trotzdem: Eine Pressestelle darf für das eigene Haus werben – ein öffentlich-rechtlicher Sender nicht. Er hat stattdessen eine redaktionelle Verantwortung und muss prüfen, ob die Behauptungen einer Pressemitteilung korrekt sind.
Das gilt besonders, wenn das Thema sensibel ist und eine reißerische Verkürzung Menschen verunsichern könnte.
Zum Beispiel Kranke, die in die Klinik gehen– vielmehr müssen.
Sie gehen ja nicht freiwillig, man kommt ins Krankenhaus, wenn es ernst ist. Kleine Zipperlein kann man zuhause kurieren und sich jeden Tag das Leibgericht schmecken lassen, was immer es ist.
Im Krankenhaus aber ist man ausgeliefert. Da muss man essen, was aufs Tablett kommt oder was die Ärzte verordnen. Und das schmeckt nicht jedem.
Darf ein Sender deshalb Angst machen und Krankenhauskost rundheraus „ungesund“ nennen?
Den Programmgrundsätzen des MDR im MDR-Staatsvertrag entspricht das jedenfalls nicht. Vielleicht müssen wir doch noch beim Rundfunkrat vorstellig werden.
(3) Alle Informationsangebote (Nachrichten und Berichte) sind gewissenhaft zu recherchieren und wahrheitsgetreu und sachlich zu halten. Nachrichten sind vor ihrer Verbreitung mit der nach den Umständen gebotenen Sorgfalt auf Wahrheit und Herkunft zu prüfen. Die Redakteurinnen oder die Redakteure sind bei der Auswahl und Verbreitung der Nachrichten zur Objektivität und Überparteilichkeit verpflichtet.
Quelle: MDR-Staatsvertrag
Was Kranke brauchen: Energie und Protein
Inzwischen fragen wir uns aber, ob es sein kann, dass in Krankenhäusern – ausgerechnet! – nur Dilettanten, Sadisten und Pfennigfuchser arbeiten, die Menschen noch kränker machen wollen, als sie ohnehin sind.
Definitiv nicht. Dabei ist Mangelernährung im Krankenhaus tatsächlich ein großes Thema, ebenso wie bei Älteren im Pflegeheim.
Doch gerade für Krankenhäuser gilt: Diese Menschen hungern nicht in der Klinik, sondern kommen schon unterversorgt dort an. Und die Ärzte können neben der eigentlichen Behandlung eine teils jahrelange Fehlernährung nicht kurieren.
Das betonen Ernährungsexpertinnen wie Monika Bischoff, Leiterin des Zentrums für Ernährung und Prävention am Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in München:
„In einem Akut-Krankenhaus gibt es kurze Liegezeiten zwischen fünf und 10 Tagen, da können wir mit Ernährung nicht so viel machen“.
In dieser Zeit aber, sagt Bischoff, kommt es vor allem auf zwei Dinge an: „Energie und Protein“, wichtig für Wundheilung, Kreislauf, Immunsystem und Erhaltung der Muskeln. Das erklärt den Fleischanteil in der Klinikkost.
Gerade in der Geriatrie gibt es oft stattdessen gehaltvolle, mit Protein angereicherte Trinknahrung – oder „Totgekochtes“.
Denn viele Ältere haben Schluckbeschwerden, leiden an Appetitmangel und Problemen im Verdauungstrakt, fühlen sich im Krankenhaus alleine, sind dement. All das beeinträchtigt die Nahrungsaufnahme.
Das Problem liegt nicht nur auf dem Teller
Entsprechend verhält es sich in Pflegeheimen. Das Problem dort ist nicht alleine das Essen. Es sind die Umstände, allen voran Personalmangel und Mangel an persönlicher Zuwendung.
Denn natürlich sind Menschen, die individuell betreut werden, die beim Essen nicht alleine sind, neben denen jemand an Tisch oder am Bett sitzt, deren Speiseplan nach ihren persönlichen Vorlieben gestaltet wurde, fitter, glücklicher und genesen schneller, wenn sie krank werden.
Das hat eine Schweizer Studie, die sogenannte EFFORT-Studie mit über 2000 Krankenhauspatienten, gezeigt, von denen ein Teil eine individuelle Ernährungstherapie erhielt, die Kontrollgruppe aber das übliche Klinikessen.
Ergebnis: Die Patienten mit der persönlich abgestimmten Kost kamen seltener auf die Intensivstation, hatten seltener lebensbedrohliche Krisen, wurden schneller gesund und hatten ein geringeres Sterberisiko.
In Zahlen ausgedrückt erlitten 27 Prozent der Patienten aus der Standardgruppe im Krankenhaus eine Verschlechterung ihres Zustands, von den Patienten mit Ernährungstherapie waren es 23 Prozent.
Ein relevanter Unterschied – aber riesig er nicht: knapp 20 Prozent.
Die richtige Ernährung kann also beim Genesen helfen, ist aber nicht der Hauptfaktor im Krankenhaus, wie oft von Kritikern suggeriert. Dafür hätte der Effekt größer sein müssen.
Volkssport im Krankenhaus: Meckern über das Essen
Natürlich könnte Klinik- und Heimessen besser, viel besser sein, natürlich müsste es mehr Geld geben, stören überbordende Hygiene- und Kühlvorschriften, müsste es mehr Personal geben.
Gerade ums Fachpersonal kämpfen seit Jahren Gesundheitsorganisationen wie der VDD, Verband der Diätassistenten und die Deutsche Gesellschaft für Ernährungsmedizin.
Sie fordern, dass alle Krankenhäuser bei der Aufnahme den Ernährungsstatus prüfen und eine qualifizierte Fachkraft für Ernährung einstellen.
Das könnte enorm viel verbessern – und ja, der Mangelernährung braucht mehr Aufmerksamkeit. Betroffen davon sind übrigens allein lebende, ältere Menschen, Krebskranke, Behinderte, die das Kochen nicht bewältigen. Ein Riesenproblem, und zwar außerhalb der Kliniken.
Fairerweise muss man auch sagen, dass viele Krankenhäuser eine ordentliche, sogar gute Verpflegung und mehrere Menüs zur Wahl anbieten, neben Vollkost auch vegetarische Gerichte und natürlich angepasste Diäten.
Das allerdings hindert viele Patienten und ihre Angehörigen nicht daran, über das Klinikessen zu meckern – Volkssport in Deutschland.
Scheinbar handelt es sich um ein psychologisches Ventil, bemerkt Monika Bischoff:
„Wir haben auch Alkoholiker, die über das Essen schimpfen, dabei leben die unter der Brücker und haben sich in den letzten Jahren praktisch nur von Alkohol ernährt.“
@Johanna Bayer
MDR online am 29.7.2025: Krankenhausessen ist ungesund und klimaschädlich
Pressemitteilung des Potsdam-Klimafolgeninstituts auf IDW mit Link zur Studie
LINK zur Spende: Sie landen bei PayPal - dann geht es völlig unkompliziert, ohne eigenes PayPal-Konto.