Nach dem SPIEGEL-Interview mit Autorin Seeburg haben wir das ganze Buch gelesen. Ergebnis: fantasierte Anekdoten, Halbwahrheiten und teils dicke Fehler. Das soll ein Sachbuch sein? Wie kommt es zu den euphorischen Pressestimmen? Die Rezension von Quarkundso.de
Das SPIEGEL-Interview zur Neuerscheinung „Wie isst man ein Mammut?“ ließ Schlimmes ahnen. Und so kam es auch.
Aber der Reihe nach: Wir haben jetzt das ganze Buch gelesen und diese Rezension wird ein langer Riemen. Die Abteilung Dokumentation und Recherche hatte das Ding in den Fingern, das sind Erbsenzähler. Die lassen nichts aus. Wer abkürzen möchte, springt am besten schnell nach unten.
Den Anfang aber macht die Chefredakteurin. Fairerhalber hält sie zunächst fest, dass das Buch nicht schrecklich ist.
Es ist sogar schön, nämlich schön geschrieben.
Auch die Idee ist nett, anhand von Gerichten die Geschichte der Menschheit zu erzählen. Bücher nach diesem Strickmuster gibt es schon, etwa „Eine Geschichte der Welt in 100 Objekten“ von Neil McGregor.
Der Mann ist Direktor des British Museum, er kennt sich also mit der Geschichte des Menschen und was Dinge darüber erzählen, wirklich aus.
Dagegen ist das Buch von Seeburg – nun ja, gut erzählt, mit fantasievollen Details ausgeschmückt, an interessanten Ereignissen aufgehängt, versehen mit schönen Erzählbögen in jedem Abschnitt. In kleinen Szenen versetzt die Autorin ihre Leser in die jeweilige Zeit.
Nur die Fakten stören.
Die ganze Geschichte der ganzen Menschheit
Die dicksten Klopper hat Seeburg schon im SPIEGEL aufgetischt, der prompt drauf reinfiel.
Nach der Lektüre dieses Fake-News-Interviews, noch mit gesträubten Haaren, hatten wir gleich in der Leseprobe zum Steinzeitkapitel einen schweren Patzer gefunden: Laut Seeburg ist Knochenmark, hinter dem die Frühmenschen her waren, „außergewöhnlich proteinhaltig“ und ließ deshalb das Gehirn wachsen.
Das ist peinlich falsch, denn Knochenmark enthält außergewöhnlich wenig Protein. Dafür steckt es voller Fett.
So etwas darf, wie wir schon angemerkt haben, bei einem Sachbuchverlag nicht durchgehen; bitte im Text zum SPIEGEL-Interview nachlesen, wird abgefragt.
Nun kommt es auf solche Pingeligkeiten vielleicht nicht an, forget the facts, push the story, wie es im Boulevard so schön heißt.
Anekdoten reichen nicht
Aber wer die Geschichte der Menschheit erzählen will, also die ganze Geschichte der ganzen Menschheit, der begibt sich auf die ganz große Bühne.
Bundesliga, wenn nicht Olympiade. Ein wirklich steiler Anspruch.
Man würde Zitate von Historikern erwarten, wissenschaftliche Belege. Doch Frau Seeburg sammelt vor allem Anekdoten, dichtet was Szenisches dazu und deutet es dann selbst gewichtig universalgeschichtlich. In der Literaturliste finden sich vor allem populäre Artikel und es ist kaum erkennbar, was Fachleute zu Seeburgs Deutungen sagen. Ob sie nachgefragt hat, ob es seriöse Studien zu ihren Thesen gibt, ist unklar.
Dabei klingt vieles seltsam für die geschilderte Epoche und ist so wohl kaum belegt, etwa die Geschichte von Fish and Chips in England. Dieses Armenessen, Street Food der Industrialisierung, verortet Seeburg in eine typisch britischen „Reihenhaussiedlung“, so fantasiert sie auf Seite 128.
Doch die Fressbuden der Arbeiter in damaligen Großstädten waren klapprige Imbisswagen, Stände auf Jahrmärkten oder verräucherte Verschläge im Erdgeschoss von Läden und Warenhäusern.
Frittierten Fisch und gebackene Kartoffeln gab es vor allem an Häfen und Docks oder nahe den Fabriken und Lagerhäusern. Da war die Kundschaft: Arbeiter, die schnell etwas Nahrhaftes essen wollten.
Fish and Chips im schmucken Reihenhaus?
Um 1860 soll einer der ersten Fisch-and-Chips-Läden im Londoner East End entstanden sein, und zwar in einem Lagerhaus, so geht die Legende. Diese Jahreszahl nennt auch Seeburg.
Das East End war zu dieser Zeit eine proletarische Gegend für Arbeiter, dunkel und verraucht, Jack the Ripper trieb dort sein Unwesen. Da stand keine „Parade roter Backsteinhäuschen“(Seeburg) in schmalen, geraden Straßen. Das East End war ein Armenviertel. Ein Slum.
Naja, man muss es ja nicht immer so genau nehmen, und schließlich erwähnt Seeburg das East End nicht explizit. Sie will nur irgendwie ein Bild von England zeichnen, und England heißt für sie nunmal Reihenhaus.
Doch das billige Klischee ist nicht nur platt, es verfälscht auch die Natur des Gerichts, um das es geht.
Teig für Arme: Mehl und Wasser
Laut Seeburg sollen nämlich 1860 Kabeljaufilets „in einer flachen Schale mit großer Beiläufigkeit in einer flüssigen Masse aus Milch, Eiern und Mehl gewälzt“ worden sein, um dann in „siedendes Öl“ zu plumpsen.
Tja. Milch und Eier in einem Armen-Essen von 1860?
Milch und Eier waren in dieser Zeit Luxus-Lebensmittel, überdies leicht verderblich. Mit denen wurde nicht in einer Panade geaast, in Imbissbuden an der Straße.
Auch war Öl um 1860 in England als Bratfett nicht üblich: Man briet in Rinderfett, beef dripping, oder anderen tierischen Fetten, frying fats.
Vor allem ist bis heute der klassische Fish-n-Chips-Teig ein Bierteig, beer batter: ein dünnflüssiges Gemisch aus Mehl und Bier. Ohne Ei.
Für Arme ging es noch einfacher: nur Mehl, Wasser und Salz.
Diese simple Mischung ist übrigens für die jüdischen Sabbatgerichte belegt, aus denen Fish and Chips entstanden sein soll. Puristen schwören noch heute darauf, sie soll die knusprigste Panade ergeben.
Fragwürdig und ahistorisch
Falls das irrelevante Pingeligkeiten sind, wollen wir auf keinen Fall weiterkritisieren. Wir hinterfragen nicht die imaginierten Zitronenscheiben auf der Glasschale für einen Nachmittagstee um 1700 (eher nicht), nicht diese Behauptung, dass das indische Curry „seine Blütezeit“ in der Mogul-Küche erlebte und von den Mogul-Höfen in „jede noch so kleine Garnisonsstadt schwappte“ (Currys sind viel älter).
Auch nicht die seltsame Sicht auf den britischen Afternoon-Tea als elitäre Inszenierung der Upper Class (der Nachmittagstee hat schon seit Mitte des 19. Jahrhunderts eine andere Rolle als gehaltvolle Mahlzeit der Armen); oder die Vorstellung, dass ein kulinarischer „Paradigmenwechsel“ in Frankreich plötzlich zu Cremesaucen mit Butter geführt hat, während Saucen vorher „keine Rolle“ spielten.
Wir wollen auch nicht die Vorstellung erschüttern, dass die Japaner auf ihrer isolierten Insel alleine den fermentierten Fisch erfanden, den sie Sushi nennen, da kam im riesigen Asien natürlich sonst keiner drauf.
Und nicht die Behauptung, dass das Bild vom Fleisch als Männeressen in der Industrialisierung entstand (falsch, ist uralt, gab es schon bei Franken und Kelten).
Wir murmeln nur verkniffen: So läuft das nicht, mit der Geschichte der Gerichte. Da ist vieles an mehreren Stellen entstanden, Einfaches und Raffiniertes existierte parallel und überall wurden Ressourcen verteilt, aßen Reiche anders als Arme, waren bestimmte Speisen einzelnen Gruppen vorbehalten.
Essen als Zeichen
Gefühlte Geschichte mit ungeniert welthistorischem Anspruch dringt bei Seeburg aber immer wieder durch: In fast jedem ihrer 50 Kapitel bescheinigt sie Essen, dass es bedeutsame, klar definierte Wendepunkte durchmacht.
Immerfort taucht plötzlich etwas auf und Essen wird zu etwas: erst schlichtes Lebensmittel, dann Distinktionsmerkmal, Statussymbol, Ritual, Marker für gehobenen Lebensstil, politisches Kampfmittel.
1920 wird die Studentenkantine, die erste Mensa, zum „Seismografen, der die politischen und gesellschaftlichen Erschütterungen innerhalb der Studentenschaft misst“, und natürlich werden Essen und Kochen in Zeiten der sozialen Medien zum Lifestyle und zum „visuellen Erlebnis“, zu einem „Gut, das auf vielerlei Ebenen konsumiert werden kann“.
So schwurbeln bestenfalls Soziologen, schlimmstenfalls Psychoanalytiker und von Baudrillard beeinflusste Literaturwissenschaftler. Wer da falsch abgebogen ist, für den gibt es keine Dinge mehr, sondern nur noch Zeichen.
Wenn Seeburg aber auf Seite 16, da ist sie in der Jungsteinzeit um 5500 v. Chr., schreibt: „An diesem Punkt der Geschichte dreht sich die ganze Existenz des Menschen ums Essen“, möchten wir widersprechen: Diesen einen Punkt gab es nicht.
Denn die ganze Existenz des Menschen drehte sich schon immer und dreht sich noch heute ums Essen.
Recherche nicht erkennbar
Die historischen Fakten dazu hat sich die Autorin, wenn überhaupt, nur oberflächlich angelesen. Besonders schmerzhaft sind die schiefen Erzählungen aus der Steinzeit, in der Antike und bei historischen Szenen zum Fleisch.
Auf die Fragen, wer wann und wie Mammuts gejagt hat, welche Rolle Fleisch in der Ernährung des Menschen spielte, wie Tiere geschlachtet wurden, ob es vegane Kulturen gab und ob Gladiatoren gar fett waren und „aufgingen wie Hefeklöße“ (Seeburg im SPIEGEL), gibt die Autorin neben ihren blumigen Deutungen falsche Antworten.
So schreibt Seeburg auf Seite 191:
„Seit dem Neolithikum etwa hat der Großteil der mitteleuropäischen Menschheit sich oftmals nur vegan ernährt, nämlich von Brot und Getreidebrei – ganz zu schweigen von Kulturen die zum Beispiel buddhistisch geprägt sind.“
Woher hat sie das? Und warum eine so weitreichende Interpretation der vielleicht nicht immer fleischlastigen Ernährung als „vegan“?
Wir befürchten ja, siehe Text zum SPIEGEL-Interview, dass Seeburg ihr graues Wissen von interessierten Kreisen bezieht. Die Sympathie für das Vegane tropft ihr jedenfalls immer wieder durch die Zeilen.
Aber gerade im kühlen Mitteleuropa war es unmöglich, sich vegan zu ernähren, ganz davon abgesehen, dass es vor Mitte des 20. Jahrhunderts keine vegane Ernährungsformen gab.
Fleisch, Fisch, Käse, Eier auf jedem Tisch
Das mit dem Buddhismus ist auch unklar: Welche Kulturen meint Seeburg, Chinesen, Japaner, Vietnamesen, Koreaner? Alles Fleischesser. Außerdem gibt es im Buddhismus kein absolutes Fleischverbot, auch nicht für Mönche. Das Thema hatten wir schon, siehe Beitrag zum SPIEGEL-Interview, aber auch den Artikel zu einem GEO-Interview mit dem Gastrosophen Harald Lemke.
Auf der Suche nach Seeburgs Quellen findet sich in ihrer Literaturliste übrigens der Klassiker von Massimo Montanari, „Der Hunger und der Überfluss“.
Gelesen hat sie ihn scheinbar nicht.
Denn Montanari beschreibt, dass seit dem Neolithikum und gerade im Mittelalter mehr Fleisch gegessen wurde als heute, von allen Schichten.
Für das 8. und 9. Jahrhundert hält der Wissenschaftler fest:
„Alle konnten sich also bei der Vorratsbeschaffung auf verschiedene Nahrungsquellen verlassen. Fleisch und Fisch (und Käse und Eier) fehlten neben Brot, Mehlbreien und Gemüse auf keinem Tisch.“
Quelle: Montanari, S. 41
Tiere steinigen, ertränken, erschlagen – wie bitte?
Was Seeburg über Fleischessen und Schlachten verzapft, ist geradezu erstaunlich. Sie stellt das orientalische Schächten als besonders tierschonend und als kunstvolle Tötungsmethode dar, die „Juden seit vielen Jahrhunderten“ praktizierten.
Dagegen seien Tiere sonst „einfach irgendwie erschlagen, gesteinigt, erstochen oder ertränkt worden“, steht auf Seite 151.
Das ist wirklich besonders krasser Unsinn, da möchte man doch glatt die Fleischerinnung alarmieren.
Denn seit Urzeiten ist das Schlachten von Tieren ein zu erlernendes Handwerk, zu dem Ausbildung und Fachwissen gehört, genau wie beim Jagen.
Schlachten muss effizient und sicher sein – niemals hat der Mensch Tiere „irgendwie“ um die Ecke gebracht. Das wäre viel zu gefährlich, zeit- und kraftraubend gewesen.
Zudem schonten die Metzger Fleisch, Fell und Knochen, die brauchte man ja. Steinigen hätte zu viel davon zerstört, Ertränken ist technisch schon schwierig, besonders bei größeren Tieren wie Rindern.
Das Handwerk der Metzger
Metzger sind von alters her Spezialisten, früher reisten sie von Hof zu Hof, um im Winter die Schweine abzustechen. In nicht wenigen Ländern ist das noch heute so, da kommt der Abstecher zu den Bauern, wenn geschlachtet wird.
Die Chefredakteurin kennt Details aus erster Hand, sie stammen aus der Zeit vor dem industriellen, maschinellen Schlachten. Töten geht kunstvoll: Geflügel dreht man den Hals um, wobei das Tier sofort ohnmächtig wird und nichts mehr merkt, das Ziel der Prozedur.
Kaninchen und Fische betäubt man durch einen Schlag gegen die Wand oder auf den Kopf. Größere Tiere werden ebenfalls betäubt, bevor man sie – fachgerecht – absticht und die großen Schlagadern öffnet.
Ochsen etwa schlug man gezielt auf den Kopf: Der Geselle fixierte das Tier, der Metzger schlug mit der stumpfen Seite der Axt zu. Das ist sehr häufig auf historischen Bildern zum Metzgerhandwerk zu sehen, hier in einem Stich von 1568:
Dass die Tiere noch etwas merken, aufspringen, fliehen und Menschen dabei verletzen, durfte aus naheliegenden Gründen nicht geschehen.
Wie die Lifestyle-Autorin Seeburg nun darauf kommt, dass Tiere in früheren Jahrhunderten „irgendwie“ um die Ecke gebracht und gar zum Schlachten gesteinigt wurden, können wir uns nicht erklären. Gut, Geschichte ist nicht ihr Fach, Ernährung auch nicht. Aber darf man dann so wild spekulieren?
Falls sie etwa das Phänomen meint, dass es im finsteren Mittelalter gelegentlich zu solchen Tierexekutionen kam, wenn sie Menschen getötet hatten: Das war und ist nicht Schlachten. Falsche Verbindung, einfach abstrus.
Und auch hier wieder: keine Quellen. Woher hat Seeburg das? Ihre Schilderung missdeutet die Sachlage jedenfalls geradezu tendenziös.

Historische Schlachtbeile: Die hintere, stumpfe Seite diente zum stumpfen Schlag auf den Schädel, der das Tier betäubt, fotografiert im Bauernhofmuseum Jexhof.

Wie ein Schwein geschlachtet wurde – Text aus dem Bauernhofmuseum Jexhof: „Mit einem Schlag auf die Hirnwulst wurde das Tier betäubt und dann mit dem Messer abgestochen, oder mit einem Dorn, den man ins Hirn trieb, getötet.
Ausgelutscht: das Mammut auf dem Teller
Auch bei ihrer Fantasie von den Urmenschen greift Seeburg erst in die Klischeekiste und dann daneben.
Die Sache mit dem Mammutsteak, das Steinzeitjäger grillen, ist ausgelutscht. Ein populärer Mythos, von der Forschung längst bereinigt um die Rolle des Sammelns, des kleineren Wilds, der Vorratshaltung.
Allerdings lassen sich damit herrliche Karl-May-Geschichten erzählen, Bilder von einer gefühlten Steinzeit, die allen einleuchten: Mensch gegen Mammut, dann das große Grillfest.
Für ihre Märchenstunde hat sich Seeburg eine spezielle Kultur von angeblichen Mammutjägern ausgesucht. Die sollen in der letzten Eiszeit, um 20.000 v. Chr., über das zugefrorene Beringmeer nach Nordamerika gekommen sein und sich dort zu „extrem erfolgreichen Jägern entwickelt“ haben: die sogenannten Clovis-Menschen.
Ach herrje, Clovis.
Warum nur nimmt sie die? Um die tobt doch seit Jahrzehnten eine Diskussion.
Rätsel der Clovis-Kultur
Es ist zum Beispiel nicht klar, woher die Vorfahren der Clovis-Leute kamen: aus dem Norden, aus dem Süden? Aus Mexiko, Mittelamerika? Vielleicht kamen sie sogar mit Booten über den Pazifik oder die Karibik angefahren und nicht übers Eis geschlittert, so eine andere Hypothese.
Jedenfalls haben sich die Clovis-Menschen nicht erst zu extrem erfolgreichen Jägern entwickelt: Sie waren das schon, sonst hätten sie und ihre Vorfahren weder in der Eiszeit überleben noch sich in Amerika ausbreiten können.
Das zeigt auch der Zeithorizont, wir stehen nämlich in Seeburgs Kapitel in der Spätphase des Homo sapiens, um 11.000 v. Chr. Da hat sich nichts mehr bei der Jagd entwickelt, sondern in der Landwirtschaft.
Warum Seeburg überhaupt nach Amerika blickt, wo doch in Europa die wahrhaft erfolgreichen Jäger, die Neandertaler, schon vor 400.000 Jahren große Tiere zur Strecke brachten, ist auch erstaunlich.
Die Clovis-Kultur steht jedenfalls nicht für einen Wendepunkt der Menschheitsgeschichte durch besonderes Jagdgeschick.
Schon die große Linie der Seeburg-Chronik stimmt also nicht.
Und die Details stimmen auch nicht.
Jagen in der Steinzeit: Tricks und Fallgruben
Denn Seeburgs Vorstellungen von der Mammut-Jagd an sich, für die, wie sie schreibt, „leichte Wurfspeere“ verwendet wurden, sind auch zweifelhaft.
Man muss sich das mal vorstellen: Ein vier Meter großer und acht Tonnen schwerer Mammutbulle mit einer 20 Zentimeter dicken Fettschicht unter dem dicken Wollfell, und dann kommen ein paar Menschlein und werfen mit Stöckchen nach ihm.
Der hätte dafür nur ein müdes Hinternrunzeln übrig.
Darüber gibt es eine anhaltende Diskussion, weil experimentelle Archäologen gezeigt haben, dass schlichte Speerwürfen auf Riesenwild wohl kaum genügten. Solche Waffen hätten nicht genügend Durchschlagskraft, um die Tiere zu verletzen.
In Alteuropa waren seit 20.000 v. Chr. bei der Großwildjagd Speerschleudern im Einsatz. Sie beschleunigten die Speere und gaben ihnen erst die nötige Wucht, um Gewebe zu durchdringen und Organe zu treffen. Darauf kam es an, wenn man große Tiere mit inneren Blutungen schwächen wollte.
In Sibirien, auch in Amerika und Mexiko stießen Archäologen aber auf Fallgruben. In einer lag ein Mammutskelett, daneben Klingen.
So herum wird eher ein Schuh draus: Die riesigen Elefanten überlisten, in Fallgruben zu Boden bringen, dann gezielt töten, indem man die großen Schlagadern am Hals zersticht. Ganz wie im Mittelalter.
Dann konnte man die Beute in Ruhe ausweiden, wofür die typisch gewellten Clovis-Klingen taugten – einige Experten gehen davon aus, dass es wohl eher Schlachtermesser waren.
Natürlich geht das mit den Fallgruben und überhaupt die Mammut-Jagd vornehmlich bei kranken, geschwächten Tieren, da ist man sich einig. Also nichts mit dem mannhaften Kampf gegen ein gefährliches Biest.
Das Schweizerische Mammutmuseum sieht es so:
„Um ein Mammut zu jagen brauchte es ein gut eingespieltes Team. So konnte etwa ein Tier mit einer Feuerkette in eine bestimmte Richtung getrieben (Feuertreibjagd) oder in einer Fallgrube mit Lanzen erlegt werden. Trotzdem dürfte die Mammutjagd nicht alltäglich und zudem gefährlich gewesen sein.“
Ein Mammut essen – wie geht das denn nun?
Eines allerdings hätte man wirklich gerne gewusst: Wie isst man denn nun ein Mammut?
Schneidet man es in Scheiben, schleppt man das Fleisch auf Tragen weg? Konserviert man es, räuchert man, salzt es ein, legt es in Fett? Wie viele Sippen essen an so einem Tier, wie lange – Essen war doch das Thema?
Aber Fehlanzeige. Diese Fragen beantwortet Frau Seeburg nicht, obwohl sie im Titel des Buches stehen.
An Fleisch kamen die frühen Steinzeitjäger übrigens auch anders: Hirsche, wilde Pferde, Büffel, Rinder und Schweine, Hasen und Vögel waren leichtere Beute als Mammuts, vom Sammelertrag ganz abgesehen.
Interessante Details gibt es in der Sache also en masse. Nur schustert sich Seeburg lieber zusammen, was ihre pseudowissenschaftliche Fabeln stützt und bestenfalls für ein Kinderbuch taugt: Der kleine Mensch gegen das Mammut.
Stille Post: Die Legende von den fetten Gladiatoren
Dicke kommt es auch bei der Geschichte von den römischen Schaukämpfern, den Gladiatoren.
Wir haben ja schon auf den ersten Blick, beim Lesen des SPIEGEL-Interviews im Juni, gemutmaßt, dass da etwas nicht stimmen kann: Trainierte Kämpfer, die fett waren und mit Hüftspeck kämpften, ja, „aufgegangen sind wie Hefeklöße“ (Seeburg im SPIEGEL): Kann das sein?
Seeburg ist sich da ganz sicher. „Tatsächlich“, steht im Buch auf Seite 48:
„Tatsächlich sind die Berufskämpfer oftmals eher pummelige Erscheinungen, wobei das zusätzliche Körperfett einen gewissen Schutz der Organe bei Stichverletzungen bietet.“
Woher hat sie das? Aus ihrer Literaturliste erfahren wir es – wieder – nicht.
Grundsätzlich gefragt: Welcher Boxer, welcher Kampfsportler ist fett oder pummelig?
Die müssen doch schnell und beweglich sein, alles andere ist unplausibel. Auch haben sie intensiv trainiert, da setzt man kein Fett an.
Seltsam ist auch die Mutmaßung Seeburgs, dass das Fett von der Getreidenahrung der Gladiatoren stamme, wofür sie übrigens den antiken Sportarzt Galen als Gewährsmann vorschützt. Aber eine Sporternährung mit vielen Kohlenhydraten – aus Getreide – macht nicht zwangsläufig fett, wie man an den drahtigen Radfahrern der Tour de France sieht.
Sucht man nach Quellen für diese schrägen Thesen, stößt man auf Artikel im Internet, die gelinde gesagt voller Spekulationen sind. Wissenschaftliche Belege gibt es – tatsächlich – nicht.
Nur eine Quelle, keine Wissenschaft
Der Ursprung scheint ein einziger Anthropologe zu sein, der Gladiatorenknochen untersucht hat.
Er hat etwas der Art in die Welt gesetzt, zwischen 2002 und 2004, allerdings nur mündlich: Gladiatoren hätten sich eine Fettschicht angefressen, um ihre inneren Organe vor Stichverletzungen zu schützen. Dies platzierte er als eigene Vermutung gegenüber Journalisten in einem Fernsehbeitrag und einem Zeitungsartikel.
In seinen eigenen, international bekannten wissenschaftlichen Studien zu den Knochen von Gladiatoren aus Ephesos steht nichts davon.
Weder, dass Gladiatoren dick waren und „aufgingen wie Hefeklöße“, wie Seeburg im SPIEGEL fantasiert, noch, dass der antike Sportarzt Galen sich zur Getreidenahrung so geäußert haben soll, dass vegetarische Nahrung fett macht.
Einer schreibt vom anderen ab, keiner fragt nach
Seit etwa 2004 aber, seit diesem Interviews mit dem österreichischen Anthropologen Karl Großschmidt, haben alle die Sache mit den dicken Gladiatoren voneinander abgeschrieben: von National Geographic bis zu SPIEGEL, STERN, und Spektrum der Wissenschaft. Die Ärztezeitung versteigt sich sogar dazu, dass Gladiatoren „fett wie Sumo-Ringer“ gewesen seien.
Die Kette unterbrechen wir – Quarkundso.de hat nachgefragt, bei einem Spezialisten.
Der sitzt an der Universität Mannheim und heißt Christian Mann. Er ist Althistoriker und Experte für Sport in der Antike.
Und nein, das mit den fetten Gladiatoren kann er nicht bestätigen. Es gibt dafür keine Belege, sagt der Professor. Stattdessen aber „Hunderte und Hunderte von Reliefs, Mosaike, Darstellungen auf Tonschüsseln, dazu Literaturstellen“ zu Gladiatoren.
„Nirgendwo sieht oder liest man, dass die Gladiatoren fett waren“, sagt Mann. Was belegt und zu sehen ist, sagt Mann, sind starke, durchtrainierte, muskulöse Kämpfer.
Wie die Spinne in der Yuccapalme
Vor kurzem war wieder einer da, von Terra X, ZDF. Der Autor interviewte Christian Mann zum Leben der Gladiatoren und wollte ihm das mit den pummeligen Getreidefressern geradezu soufflieren: Der Wissenschaftler sollte im O-Ton erzählen, dass Gladiatoren fett waren und sich eine Speckschicht anfraßen, um sich vor Stichen zu schützen.
Christian Mann tat das nicht.
Der Autor ließ sich laut Mann belehren, doch die Legende hat sich verselbständigt wie die von der Spinne in der Yuccapalme. Im fertig geschnitten ZDF-Beitrag von März 2023 taucht sie im Sprechertext als diskrete Vermutung wieder auf:
„Aber gestählte Athletenkörper hatten sie deshalb nicht unbedingt. Vermutlich aßen sie sich sogar eine leichte Fettschicht an, um sich vor Verletzungen zu schützen.“
Quelle: ZDF, Gladiatoren – Stars oder Verbrecher? – Terra X vom 5.3.2023 auf Youtube
Kann man nachhören, Link zum Beitrag mit Timecode steht unten.
Was die angeblich vegetarische lebenden Gladiatoren angeht, von denen Seeburg schreibt, sieht die Wahrheit laut Professor Mann auch anders aus: Ja, die Berufskämpfer haben überwiegend vegetarisch gegessen – in Ephesos.
Aber es gab dort auch Fleisch, eiweißreiche Bohnen und Linsen, wenn auch in geringerem Maße. Das steht sogar in der Ephesos-Studie von Karl Großschmidt schon, ermittelt aus Knochenanalysen.
In anderen Gladiatorenkasernen kann man aber ganz anders gegessen haben, auch mehr Fleisch, erklärt Mann: „Wer sagt denn, dass die Ernährung in jeder Kaserne und für alle gleich war? Das ist extrem unwahrscheinlich. Es gab Gladiatorenschulen von Britannien bis Ägypten, in dem riesigen römischen Reich.“
Google-Recherche reicht nicht
Nirgends, erklärt Althistoriker Mann, gibt es seines Wissens irgendeine Literaturstelle, ob bei dem antiken Sportarzt Galen oder anderswo, in der steht, dass eine angefutterte Speckschicht Gladiatoren vor inneren Verletzungen schützt.
Dann seufzt Mann am Telefon hörbar: Historiker, bedauert er, „werden leider nie gefragt, wenn Leute aus anderen Disziplinen über Geschichte spekulieren, etwa Ökonomen oder Naturwissenschaftler. Die reden dann über die Geschichte von irgendwas, kennen aber die Belege gar nicht.“
So entstünden Legenden, die sich durch schlechtes Surfen im Netz halten: Auf der ersten Seite stehen die Treffer von Google mit Quatsch. Den nehmen alle.
Auf Seite 18 steht der eine Treffer, der den Unsinn widerlegt.
Aber da, sagt Mann, schaut keiner hin.
Fazit: Ein Märchenbuch, kein Sachbuch
Wir müssen jetzt zum Ende kommen, unser Fazit: Das Werk von Uta Seeburg ist eher ein Märchenbuch als ein Sachbuch – und schadet der Wissenschaft.
So etwas ist kein Kavaliersdelikt. Schon gar nicht in den heutigen Zeiten, und verantwortlich sind die, die so etwas drucken. Die letzten Worte gehen daher an den Verlag DuMont, auch an die Kolleginnen und Kollegen von der Presse haben wir Fragen:
Wo war das Fachlektorat, DuMont? Oder überhaupt das Lektorat?
Sollte ein Sachbuchverlag den Inhalt eines Manuskripts nicht wenigstens grob prüfen? Müssten plumpe Fehler wie der mit dem Knochenmark nicht jemandem auffallen?
Wie kommt es, liebe Kollegen, zu diesen euphorischen Pressestimmen für ein an viele Stellen schlecht recherchiertes, pseudowissenschaftliches Tralala?
Trend: Geschichte der Ernährung einfach umdeuten
Dabei steht, was das Wissen über Essen, Esskultur und Ernährung angeht, etwas auf dem Spiel: eine Art Revisionismus wie im Historikerstreit über die Nazizeit betrifft gerade auch Essen und Ernährung.
Aggressives Umdeuten des Allesfressers Mensch in einen Vegetarier oder gar Veganer, das Fälschen der Ernährungsgeschichte und der Evolution, Pseudowissenschaft, das Mutmaßen über die Steinzeit, Nichtwissen, was grundlegende Fakten in der Ernährung angeht, nehmen gerade wieder überhand.
Die erste Welle kam nach 2010, inzwischen rollt die zweite, im Windschatten von Klimakatastrophe und Ernährungswende. Doch selbst wenn man für die Zukunft in der Ernährung umdenken muss: Der Zweck heiligt nicht die Mittel. Niemand darf deshalb die Geschichte leugnen. Oder die Wissenschaft.
Anderswo regt sich Widerstand gegen derart wildes Wissen: Gerade haben 30 Experten gegen den Bestseller eines Förster protestiert, der Bäumen eine Seele zuschreibt, berichtet die FAZ am 20.9.2023. Sie fordern, dass Verlage bei Sachbüchern populärwissenschaftlichen Thesen überprüfen müssen.
In diesem Sinne bleiben wir dran. Versprochen.
©Johanna Bayer
Beginn der Legende von den fetten Gladiatoren, u.a. aus der Ärztezeitung von 2004: Fett wie Sumo-Ringer, Basis ist eine Meldung der dpa.
ZDF, Terra X vom 5.3.2023, Screenshot bei TC 9:10
Teil 1 zu Uta Seeburg: das unsägliche Interview im SPIEGEL, kommentiert von Quarkundso.de. Und gemeldet beim Deutschen Presserat, der SPIEGEL hat nach unserem Beitrag seine Überschrift geändert.
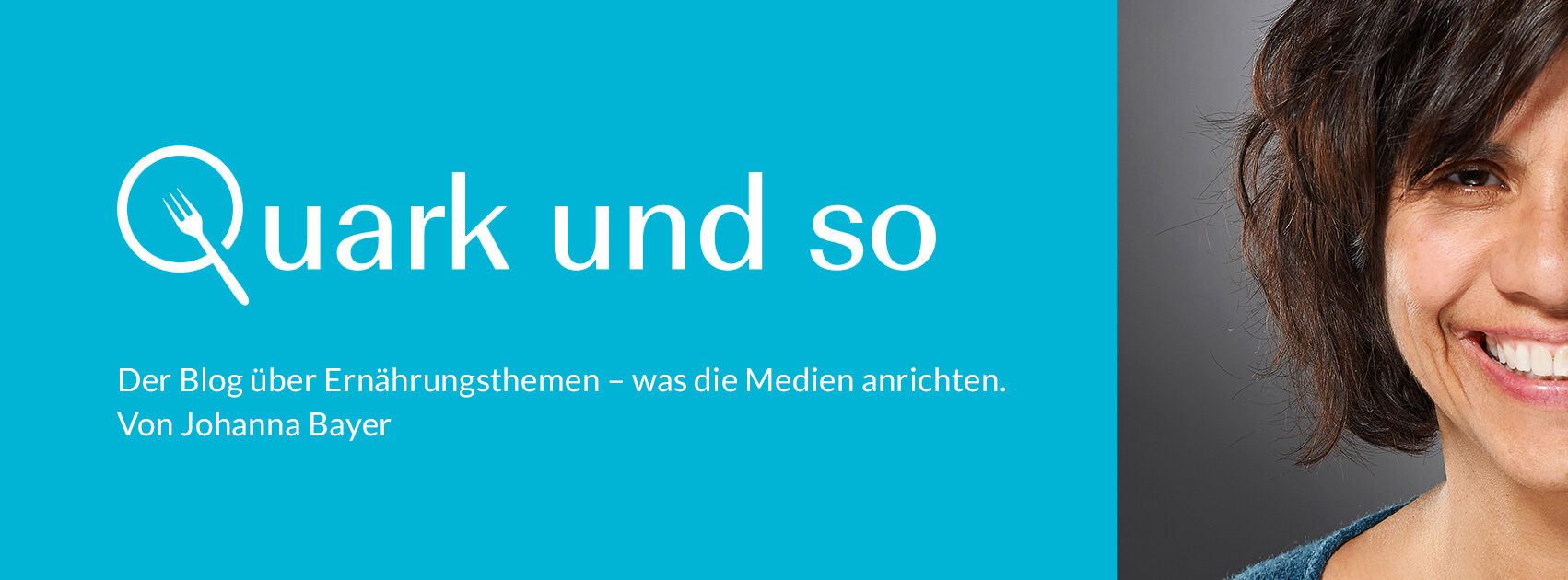













Stefanie
Diese Rezension legt offen, wie essentiell es ist, Ernährungsinformationen kritisch zu hinterfragen. Seeburgs Buch zeigt, dass pseudowissenschaftliche Behauptungen ohne ausreichende Beweise leicht als Fakten missverstanden werden können. Eine fundierte wissenschaftliche Basis ist für das Verständnis unserer Ernährung unerlässlich. Wir müssen Wissenschaft und gründliche Forschung als Grundpfeiler der Ernährungskommunikation etablieren, um Fehlinformationen entgegenzuwirken.
Johanna Bayer
Vielen Dank für den Kommentar! Wir arbeiten dran 🙂
Viele Grüße – die Chefredaktion
Ulrike Gonder
Liebe Johanna, dieses Interview war mir entgangen, ich bin jedoch im Nachhinein entsetzt darüber. Leider scheint Derartiges heutzutage immer üblicher zu werden. Zwar bin ich auch schon auf die Gladiatorennummer reingefallen – umso mehr bin ich Dir dankbar für das genüsslich zu lesende Zerpflücken dieses Interviews. Bleibt zu hoffen, dass die Presse irgendwann mal wieder aufwacht.
Danke Johanna, gute Arbeit!
Johanna Bayer
Danke für den Kommentar, liebe Ulrike! In diesem Fall ist es ja nicht nur die Presse, liebe Ulrike. Es sind Abteilungen und Redaktionen von Verlagen. Wie es scheint, gibt es da noch weniger Kontrolle oder Selbstverpflichtung als in den Fernseh- und Zeitungsredaktionen. Liebe Grüße!
Christof Schardt
Gut recherchierte und genüßlich zu lesende Lektüre, wie immer. Vielen Dank.
Johanna Bayer
Herzlichen Dank!